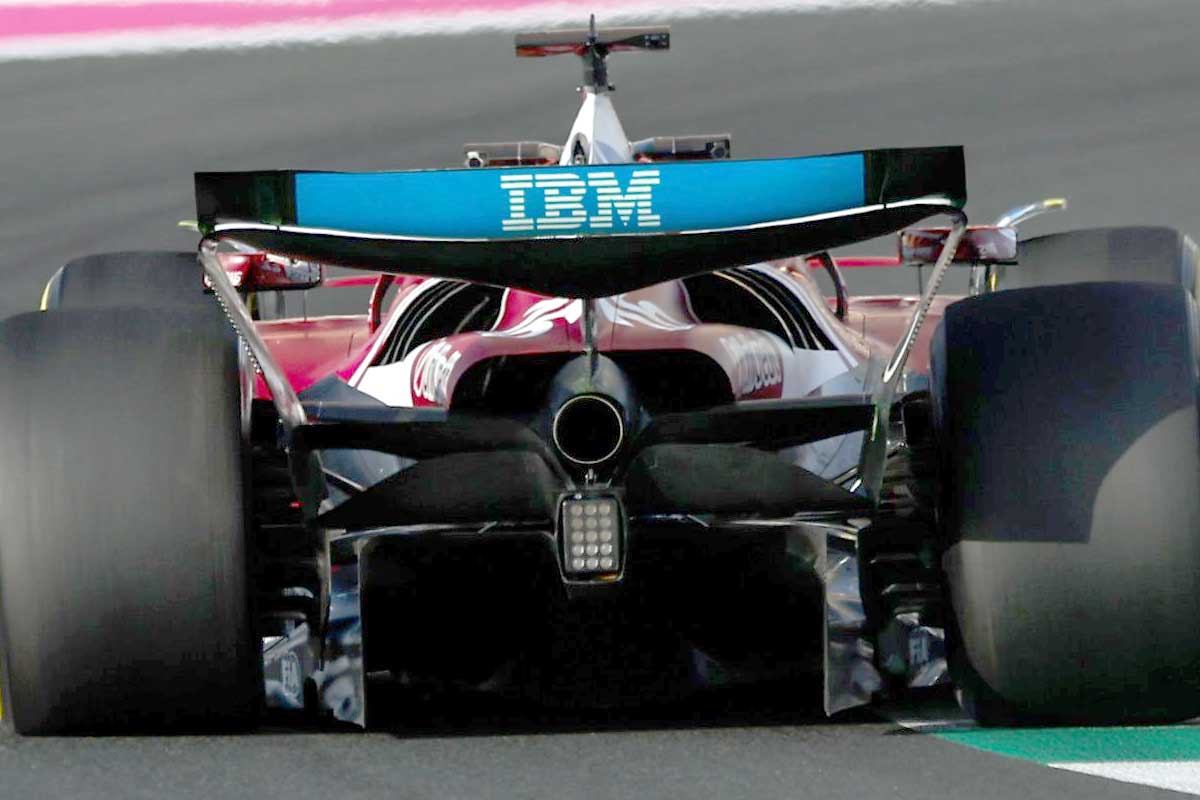
Vor einer Woche berichteten wir bereits über aufkommende Sorgen um den zukünftigen Ferrari-Motor für 2026Ein neuer Motorenzyklus beginnt in Formel 1. Weniger als eine Woche später bestätigte das deutsche Medium Auto Motor und Sport, was viele bereits vermutet hatten: Ferrari (wie auch andere Motorenhersteller) sieht dieser technischen Revolution nicht so zuversichtlich entgegen wie Mercedes und versucht immer noch, die Spielregeln zu beeinflussen.
Mercedes zuversichtlich, Ferrari und Red Bull drängen auf Wechsel
Während Mercedes in Bezug auf die Vorschriften für 2026 olympische Ruhe ausstrahlt, drängen Ferrari und RB Powertrains weiterhin darauf, die Leistungsverteilung zwischen dem Verbrennungsmotor und dem Elektroantrieb zumindest im Rennen zu ändern. Ein Beharren, das viel über die Zweifel aussagt, die in Maranello herrschen.
Die derzeitige Regelung sieht ein Gleichgewicht von 55 % thermisch / 45 % elektrisch vor. Ferrari und Red Bull würden diese Verteilung gerne in Richtung mehr Wärmeleistung verschieben und führen dafür Argumente an, die sich auf die Sicherheit und die Attraktivität des Sports beziehen. Hinter den Kulissen scheint es jedoch klar zu sein, dass beide Teams vor allem versuchen, einen Rückstand bei der Entwicklung ihres Hybridmotors auszugleichen.
Das deutsche Medium AMuS berichtet, dass ein neuer Vorschlag bei der nächsten F1-Kommission diskutiert werden soll. Der Vorschlag sieht vor, die elektrische Leistung in den Rennen auf 200 kW zu reduzieren (ursprünglich waren 350 kW vorgesehen), während die derzeitige Verteilung in der Qualifikation beibehalten werden soll. Ein technischer Kompromiss, der eine gewisse Aufregung verraten würde.
Ein Déjà-vu: Das Gespenst von 2014 schwebt über 2026
Für Ferrari und seine Kunden von 2026 (Cadillac und Haas) ist das gefürchtete Szenario glasklar: das Jahr 2014 noch einmal erleben, als der Mercedes-Motor das Feld bei der Einführung der V6-Hybridfahrzeuge unverschämt dominiert hatte. Eine Leistungslücke, die so groß war, dass es mehrere Spielzeiten dauerte, bis sie geschlossen werden konnte.
Die Angst ist umso greifbarer, als Mercedes unnachgiebig bleibt. Toto Wolff nimmt kein Blatt vor den Mund: "Das ist ein richtiger Sketch. Wir reden jede Woche darüber, aber die Regeln sind festgelegt. Man muss ihnen eine Chance geben". Mercedes lehnt ebenso wie Audi und Honda jede Änderung ab, da sie der Meinung sind, dass jede verspätete Änderung der Stabilität und Glaubwürdigkeit der Formel 1 schaden würde.
Warum dieser Druck von Ferrari?
Wenn Ferrari so gelassen wäre wie Mercedes, würden sie wahrscheinlich die gleiche Kontinuitätsrhetorik an den Tag legen. Aber die Beharrlichkeit, mit der das Verhältnis zwischen Verbrennungsmotor und Elektroantrieb angepasst werden soll, deutet darauf hin, dass der Motor 2026, mit dem der Ferrari 2026 ausgerüstet werden soll, nicht in der Lage sein wird, das Verhältnis zwischen Verbrennungsmotor und Elektroantrieb anzupassen. ScuderiaHaas und Cadillac, könnte nicht das erhoffte Niveau erreichen. In einer Ära, in der die Elektrifizierung fast 50 Prozent der Gesamtleistung ausmachen wird, könnte dieses Defizit sehr teuer werden.
Ein weiterer aufschlussreicher Fakt ist, dass Alpine vor kurzem sein eigenes Motorenprojekt für 2026 aufgegeben hat und stattdessen auf den Mercedes-Block setzt. Eine strategische Entscheidung, die viel über die aktuelle Wahrnehmung von Motorenherstellern aussagt.
Ein technischer und politischer Kampf
Die Formel 1 ist auch ein Spiel um Einfluss. Durch den Versuch, eine Änderung der thermischen/elektrischen Verteilung zu erreichen, hoffen Ferrari und Red Bull, einen weiteren Zyklus der technischen Dominanz zu vermeiden. Aber um die Regeln zu ändern, braucht man eine Mehrheit von vier von fünf Triebwerksherstellern, ein heute unwahrscheinliches Szenario.
Die FIA steht also vor einem Dilemma: Soll sie eine teuer erkaufte regulatorische Stabilität bewahren oder eine riskante Lücke mit potenziell weitreichenden technischen, wirtschaftlichen und politischen Folgen öffnen?